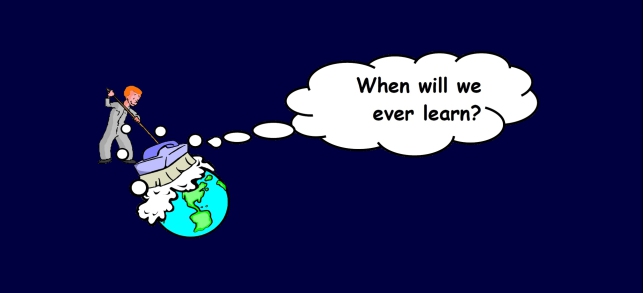Don't call it Wirtschaftskrise!
April 2020
Wir haben viele Krisen - aber wenn wir von einer „Wirtschaftskrise“ sprechen, befinden wir uns automatisch im Narrativ des „Höher-Schneller-Mehr“. Dann übersehen wir die systemischen Probleme und werden zu den falschen Maßnahmen greifen.
Zwischen 5 und 7 Prozent Schrumpfung des BIP erwartet die Bundesregierung in ihrer neuen Frühjahrsprognose. Von „Rezession“ sprechen derzeit die Wirtschaftsmedien (obwohl die Lehrbuchtheorie für Phasen einbrechender Inlandsprodukte den Begriff der Depression vorhält). Kaum ein Kommentator, der die Sorge um Wohlbefinden und Leben nicht auf die „ökonomische Gesundheit“ übertragen würde. Doch was den meisten Kommentaren gemein ist, sie fußen auf einer Wirtschaftstheorie, die uns seit Jahrzehnten kurzfristige Profite, aber wachsende Gefahr von Zusammenbrüchen in der nahen Zukunft verheißt. Werden wir konkret. Denn die Rede von der „Wirtschaftskrise“ lässt sich zwar gut in Schlagzeilen packen, schiebt aber die Verantwortung für den Schlamassel allein dem Virus in die Schuhe und liefert dem eurostarken Wirtschaftspolitiker die Bühne, sich zum Retter aufzuschwingen. Sie verstellt in ihrer bequemen Verkürzung der Sachlogik den Blick auf zukunftsfähige Lösungen. Und zukunftsfähige und durchdachte Lösungen sind es, die in einer Bildung für nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt stehen sollten.
Was wir konstatieren müssen, wir haben eine medizinische Krise, in der die Labor- und Behandlungskapazitäten nicht ausreichend auf ungewöhnlich hohe Fallzahlen ausgerichtet sind. Doch auf der anderen Seite haben wir Branchen, die massive Umsatzzuwächse verzeichnen können. Jeff Bezos hätte unter diesem Aspekt sicher keine Probleme mit einem verlängerten Lockdown… Wir haben Unternehmen, die spontan auf Masken- oder Desinfektionsmittel umstellen konnten. Wir haben Produktionsbetriebe, die mangels Zulieferung ihre Belegschaften auf Kurzarbeit schicken. Wir haben Pharmaunternehmen, die auf der Suche nach Impfstoffen Nachtschichten einlegen. Wir haben Branchen wie den Profifußball und die Gastronomie, in denen kritische Liquiditätsprobleme entstehen. Millionen hinter den Bildschirmen erleben sich im Homeoffice und Homeschooling und lassen die Digitalisierungsindustrie jubilieren. Freie Kulturschaffende müssen ohne jegliche Einnahmen improvisieren. Obdachlosen fehlt der letzte Euro in der Sammeldose. Und wir haben beamtete Staatsbedienstete, die diverse Sorgen und chaotische Alltagssituationen umtreiben, aber nicht der Blick auf die Gehaltseingänge auf dem Kontoauszug. Haben wir eine Wirtschaftskrise? Damit machen wir es uns zu einfach, denn wir übersehen die Chancen und benennen die Probleme nicht: Ökonomisch haben wir eine Versorgungskrise, da gesellschaftliche Infrastrukturen jahrzehntelang auf Kosteneffizienz ohne Sicherheitsnetz geeicht wurden, eine Verteilungskrise, in der Krisenprofiteure an den Börsen ihre Gewinne an den Sozialsystemen vorbei erzielen, und eine Anspruchskrise, weil unsere liebgewonnenen Fernurlaube und Konsumorgien erst mal nicht mehr möglich sind. 6% weniger Inlandsprodukt in 2020 wäre viel – aber niemand leidet Hunger.
Gleichzeitig machen viele von uns neue, wunderbare Wohlstands-Erfahrungen der Entschleunigung. Wer hat noch nicht das entspannte Schlendern im Stadtzentrum, die abendliche Ruhe ohne hintergründigen Autoverkehr, blaue, kondensstreifenfreie Himmel genossen? Umweltmessstationen vermelden unglaubliche Verbesserungen der Luftqualität - abgesehen von Corona-Angst können Asthmatiker gerade aufatmen. Und wider aller Erwarten wird Deutschland 2020 sein CO2-Reduktionsziel erreichen. Wollen wir diese „Wirtschaftskrise“ überwinden?
Es ist wahr, da aktuell viele finanzielle Existenzen gefährdet sind, ist eine effektive und schnelle Unterstützung durch den Staat jetzt unbedingt zu prüfen. Wer aber undifferenziert der Wirtschaftskrise das Wort redet, wird keine Ruhe geben, bis die Ausbeutung von Mensch und Natur wieder in neue Höhen getrieben worden ist. Er wird die größte Chance seit Jahrzehnten verpassen, unsere Wirtschafts- und Produktionsweise an die ökologischen Leitplanken anzupassen und soziale und globale Gerechtigkeit endlich ernst zu nehmen. Wird nun wieder die am vermaledeiten BIP gemessene quantitative Güterproduktion als Maßstab genommen, bevor das gesellschaftliche Krisenszenario beendet wird, wird das der nächsten, vermutlich nicht mehr zu heilenden Krise den Boden bereiten. Noch einmal können Staatsschulden in die Höhe geschraubt werden, um Erfolgsmeldungen bei BIP, „Wachstum“ und „Konjunktur“ zu produzieren. Ob „Green New Deal“ oder „Brown New Deal“, das BIP wird uns erst dann entspannen, wenn Umweltzerstörung, Hektik und soziale Konkurrenz wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angelangt sind. In der Zwischenzeit nähern wir uns unweigerlich den globalen Klimakipppunkten und können durch die Corona-Erfahrung vermutlich nicht mal im Ansatz erfassen, welch menschliches Leid von klimatisch bedingten Naturkatastrophen ausgehen wird.
Jetzt müssen wir schleunigst unser Denken ändern, unsere Sprache – und unsere Bildung. Ein „Back to Business as Usual“ darf es nicht mehr geben. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, dass unser bisheriges, auf maximale Ausbeutung getrimmtes Wirtschaftssystem eine Sackgasse ist. Als Pädagog*innen sind wir nun gefordert, eigenständig zu denken und gemeingefährliche ökonomische Lehrpläne zu hinterfragen. Nutzen wir die Chance. Sie wird vermutlich nicht mehr wiederkommen.