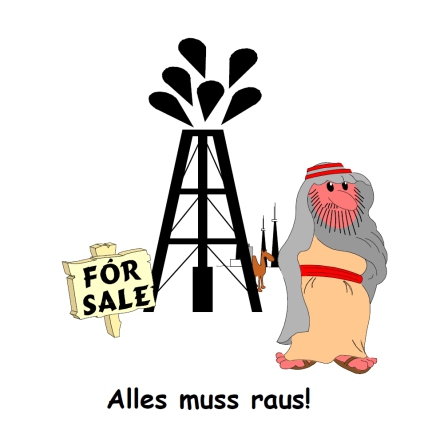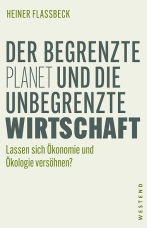Klimagerechtigkeit kann die Welt nicht retten – aber Menschen
Oktober 2020
Politik und Klimabewegung mangelt es an ökonomischem Sachverstand. Und der Ökonomie an wissenschaftstheoretischer Demut. Ein Streifzug durch Heiner Flassbecks neues Buch "Der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft" stellt liebgewonnene Überzeugungen auf die Probe. Lassen sich Ökonomie und Ökologie versöhnen?
Mit der Ökonomie ist das so eine Sache. Einerseits hilft sie die Welt besser zu verstehen und ein auskömmlicheres Leben zu führen. Andererseits vernebelt sie die Zusammenhänge und ist ursächlich an der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen beteiligt.
Der Eindruck einer solchen Schizophrenie beschleicht Leser*innen auch bei der Lektüre des neuen Sachbuchs „Der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft“(1). Der Autor, Heiner Flassbeck, mittlerweile emeritierter Wirtschaftsprofessor, ist dem politischen Chronisten kein Unbekannter. Ende der 90er Jahre war er als Staatssekretär der wichtigste wirtschaftspolitische Zuarbeiter eines gewissen Oskar Lafontaine, des vermutlich letzten Finanzministers, der die Entscheidungshoheit der Politik vor dem Zugriff der Finanzmarktlobby bewahren wollte. Lafontaine, so schreiben es inzwischen die Geschichtsbücher, scheiterte, so wie Flassbeck seither als UN-Volkswirt nur noch außerhalb des politischen Tagesgeschäfts mit geistreichen Veröffentlichungen gegen den neoliberalen Einheitsbrei von Wirtschaftswissenschaft, Politik und Medienbetrieb anschrieb.
Umso spannender erweist es sich, seine Perspektive auf die Klima-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsproblematik zu erkunden. Denn deren Provokation kann ein Ökonom mit keynesianischer Prägung nicht unkommentiert stehen lassen: dass die Wirtschaft begrenzt sei. Gilt doch im nachfrageorientierten Denksystem die Vollbeschäftigung als das, sagen wir, „sympathischste“ Ziel der makroökonomischen Steuerung, die sich am Magischen Viereck orientiert. Und wenn Vollbeschäftigung als unmittelbar abhängig vom Wirtschaftswachstum betrachtet wird, wird die Idee einer „Steady-State-Economy“ (Herman Daly) oder einer Postwachstumsökonomie (Niko Paech) aus arbeits- und sozialpolitischer Perspektive unannehmbar.
Keynesianismus und Ökologie sind nicht versöhnbar
Insofern ist Flassbecks Absage an alle Wachstumskritik keine Überraschung. Und obwohl er den menschgemachten Klimawandel als herausragendes politisches Aktionsfeld dieses Jahrhunderts benennt, kommen bei ihm das Pariser Klimaabkommen, aber gerade auch die deutsche Energiepolitik besonders schlecht weg: ein gleichzeitiger Ausstieg aus Atom- und Kohlestrom sei volkswirtschaftlich und versorgungstechnisch nicht zu machen. Nein, Argumente, die den Untertitel des Buches „Lassen sich Ökonomie und Ökologie versöhnen?“ belegen würden, finden sich nur wenige. Als einzige Hoffnung empfiehlt er den „grünen Strukturwandel“, in dem Arbeitsplätze aus ökologisch besonders bedenklichen Branchen allmählich in nachhaltigere Strukturen überführt werden – wobei am Ziel des Wirtschaftswachstums nicht zu kratzen sei.
All das sind keine sehr innovativen Ideen. Worin liegt dann der Wert seiner Ausführungen? Flassbeck neigt, wie viele „altersweise“ Ökonom*innen, dazu in einem Rundumschlag in Richtung Politik, Medien, aber auch Zivilgesellschaft auszuteilen. Das mag nicht jeder gefallen. Doch finden sich darunter Kritikpunkte, die nicht nur der neoliberal dominierten Mainstream-Wissenschaft, sondern auch einer ökonomisch irrational (sprich: wirklichkeitsfremd) argumentierenden Klimabewegung geschuldet sind und die seit Jahrzehnten ursächlich dazu beitragen, dass in der nationalen Klimapolitik oder auf internationalen Konferenzen nennenswerte Fortschritte erkennbar werden.
Nur der Preis ist heiß – die Marktwirtschaft braucht verlässliche Signale
Die Argumentation läuft auf zwei Forderungen hinaus, sollen fossile Brennstoffe dauerhaft aus den Märkten herausgedrängt werden:
1. Die Nachfrage muss sinken. Dies geschieht jedoch nur
dann, wenn der Preis für fossile Brennstoffe auf Dauer steigt (und zwar stärker als die allgemeine Einkommenszunahme). Im Buch ist die Rede von einem Zeitraum von „hundert Jahren“. Nur so werden sich
längerfristige Investitionen von Unternehmen und die Konsumgewohnheiten der Haushalte ändern. Die Steigerung muss kontinuierlich sein, weil sich sonst die Nachfrage nur an das gestiegene Preisniveau
anpasst, aber keine Substitutionsprozesse einleitet. Flassbeck setzt zurecht auf die Preislösung. Denn eng definierte Verwendungen von Rohöl-Produkten durch Einzelvorschriften, Grenzwerte oder
ähnliches zu regulieren, würde zu einem Flickenteppich an Ge- und Verboten führen, der das Ziel der Verbrauchssenkung bei weitem nicht so wirkungsvoll erreichen würde wie Preissignale (ob durch
CO2-Steuer oder CO2-Emissionszertifikate hängt vom Regime der teilnehmenden Akteure ab).
Diese Forderung ist Common Sense und die Klimabewegung appelliert zurecht an die Politik, hier endlich für langfristig wirksame Lösungen zu sorgen. Doch die zweite Forderung hört man deutlich seltener:
2. Das Angebot muss sinken. Hier liegt – da legt Flassbeck den Finger in eine offene Wunde der allgegenwärtigen Klimadiskussion – das größte Problem. Alle Versuche den CO2-Ausstoß durch Minderverbräuche zu senken, sei es durch individuellen Konsumverzicht, sei es durch staatlich gelenkte Preissignale oder im Rahmen einer Energiewende, werden nämlich durch den berüchtigten „Rebound-Effekt“ konterkariert. In den Nachhaltigkeitswissenschaften ist der Rebound-Effekt seit langem bekannt. Und doch tun fast alle Diskutant*innen und Klimabewegte so, als gäbe es den Rebound-Effekt nicht. Sinkt nämlich die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen, so wird auf globalen Märkten auch deren Preis sinken. In gleichem Maße werden dann wieder neue Verwendungsmöglichkeiten für den Rohstoff attraktiv. Die Nachfrage verschiebt sich also nur, anstatt den Verbrauch global zu mindern. Dieses Problem wurde, so Flassbeck, noch auf keiner einzigen Klimakonferenz auch nur im Ansatz versucht zu lösen. Denn es würde bedeuten, dass die Weltgemeinschaft für eine künstliche Verknappung fossiler Brennstoffe sorgen müsste: Kohle, Erdöl und Gas müssen nachweislich dort verbleiben, wo sie liegen – im Boden.
Ganz neu ist diese Forderung nicht. Bereits vor 20 Jahren forderte der Osnabrücker Politikwissenschaftler Mohssen Massarrat eine globale Allianz, die die Anbieterstaaten dazu verpflichtet (bzw. entsprechend belohnt), für eine Verknappung des Angebots zu sorgen.(2) Ansonsten bleibt auf Dauer der Anreiz bestehen, die Rohstoffe aus der Erde zu holen und auf den Märkten anzubieten. Und der Markt sorgt für „Markträumung“, das lernen Wirtschaftsstudierende in ihrem ersten Semester.
Nationale Reduktionsziele als Milchmädchenrechnung
Insofern scheinen auch nationale CO2-Reduktionsziele für das Weltklima wirkungslos – denn in dem Maße, indem ein Land z. B. seinen Ölverbrauch reduziert, sinkt tendenziell der Rohölpreis auf dem Weltmarkt und lädt andere Nachfrager dazu ein, ihren Ölverbrauch wiederum zu steigern. Diesen Mangel an ökonomischer Einsicht wirft Flassbeck auch der FridaysForFuture-Bewegung vor. Appelle in Richtung Verzicht und Selbstbeschränkung seien überhaupt nur für wohlhabende Schichten des westlichen Bürgertums eine Option. Weltweit gesehen sei es ausgeschlossen, dass über Demonstrationen oder eine individuelle Änderung des Lebensstils überhaupt jemals etwas erreicht würde.
Das ist starker Tobak – denn damit attestiert Flassbeck den vielen Millionen wohlmeinenden Konsument*innen und politisch Aktiven, die individuell versuchen ihren ökologischen Fußabdruck zu senken oder sich sogar für nationale/internationale Klimaziele einsetzen, ökonomisch naiv zu handeln.
Die Grenzen ökonomischer Denksysteme - einige hoffnungsvolle Gegenargumente
Naivität – diesen Vorwurf müssen sich Ökonom*innen aber ihrerseits anhören, wenn man auf die eingeschränkt aussagefähigen Modellannahmen ihrer Wissenschaft abzielt. Und tatsächlich verbleiben auch Flassbecks Sachargumente in den engen Grenzen des (makro)ökonomischen Denkens. Dabei können aus Praxissicht drei Einschränkungen seiner – im Kern – schlüssigen Argumentation gegeben werden:
- Es mag richtig sein, dass individuelle oder gesamtgesellschaftliche Anstrengungen zur Senkung des fossilen Primärenergieverbrauchs global gesehen durch den Rebound-Effekt konterkariert werden. Unter Entwicklungs- und Gerechtigkeitsaspekten sind solche Einsparungen aber trotzdem hilfreich, denn sie erlauben bisher benachteiligten Volkswirtschaften und Gesellschaftsgruppen einen leichteren Zugang zu Erdölprodukten und -dienstleistungen. Eigentlich erstaunt es, dass Flassbeck, den die Sozialverträglichkeit von Politik und Ökonomie schon immer besonders stark umtrieb, diese Chance des Rebound-Effekts nicht anerkennt, sondern lediglich als Gegenargument gegen die ökologische „Weltrettung“ verwendet. Die Klimabewegung vertritt seit einiger Zeit besonders stark den Slogan der „Klimagerechtigkeit“. Damit hat sie insofern Recht, als die Energieeinsparung der Reichen den Armen der Welt zu mehr (fossiler) Entwicklung verhelfen kann. Wo hingegen Flassbecks Argumentation zutrifft: diese Art von „Klimagerechtigkeit“ wird den Klimawandel nicht aufhalten (sondern seine Verursachung ökonomisch nur auf mehr Schultern verteilen, also eine Form der „CO2-Gerechtigkeit“ schaffen).
- Ökonomische Modelle haben oft den Nachteil, das Marktgeschehen unter Abstraktion des Faktors Zeit zu betrachten. Im vollkommenen Markt der Neoklassik geschieht alles im selben Augenblick. Diese Modellannahme ist in der Realität natürlich zu hinterfragen. Wenn die Nachfrage nach Rohöl sinkt, so sorgt die digitalisierte Ökonomie zwar inzwischen für immer schnellere Reaktionen des Marktes. Trotzdem vergeht in der echten Welt durchaus etwas Zeit, bis eine neue Verwendung des eingesparten Brennstoffs gefunden worden ist. In gewissen Sinne wird der Verbrauch damit zeitlich etwas gestreckt. Und die Zeitfrage ist bei der Suche nach klimapolitischen Lösungen eine wichtige.
- Ebenfalls erstaunlich ist, dass Flassbeck die Knappheitsfunktion des Preises als Signal für die Investitionstätigkeit der Unternehmen ausblendet. Wenn durch Einsparung von fossilen Brennstoffen deren Weltmarktpreise tendenziell sinken oder weniger stark steigen, so lohnt die Neuerschließung von Rohstoffquellen in geologisch schwierigen Regionen weniger als wenn es eine überbordende Nachfrage danach gibt. Somit ist doch zu hoffen, dass besonders kostspielig zu erschließende Vorräte tatsächlich erst mal im Boden bleiben. Das Argument entkräftet nicht die Forderung nach einer Deckelung des Angebots, gerade auch weil die Erschließungskosten durch den technischen Fortschritt natürlich im Zeitablauf auch sinken. Doch auch hier greift wieder das Argument, dass wir Zeit gewinnen. Und sei es nur jene Zeit bis zum globalen Klimakollaps. Sollte dieser nicht aufzuhalten sein – dahin gehend muss man die Quintessenz des Buches ja interpretieren – so sollten wir doch alle an seiner Verzögerung interessiert sein. Das ist – zugegeben – kein sehr moralischer Ansatz. Aber die primär moralistische Argumentation weiter Teile der Klimabewegung geht unter pragmatischen Gesichtspunkten an einer lösungsorientierten Debatte meist vorbei.
Somit - das ist die gute Nachricht - geben individuelle oder auch nationalstaatliche Strategien der CO2-Reduktion weiterhin einen Sinn. Findet die Weltgemeinschaft aber keine Wege, das Angebot an fossilen Rohstoffen zu bremsen (und seit Jahrzehnten steigt die weltweite Erdölproduktion kontinuierlich weiter), dürften die nachfrageseitigen Bemühungen den Klimawandel bestenfalls verzögern, aber nicht stoppen. Das ist die beunruhigende Nachricht. Aber wir dürfen die Augen davor nicht verschließen und müssen das kurze Zeitfenster, das wir vielleicht noch haben, nutzen.
Moralistischer Wohlfühl-Konsens und ökonomische Zusammenhänge
Es ist wahr, modelltheoretische Scheuklappen sind für Ökonom*innen keine Seltenheit, und auch im Falle Heiner Flassbecks verhindern sie, dass er z. B. den Arbeits- und Einkommensbegriff aus dem erwerbswirtschaftlichen Korsett befreit, wie es der Vordenker der Postwachstumsökonomie, Niko Paech, tut. Und eine alternative Definition von „Wirtschaft“ jenseits der Messung mittels Bruttoinlandsprodukt scheint für Flassbeck außerhalb des Vorstellungsvermögens. 50 Jahre keynesianisch geprägte Makroökonomik schüttelt man auch nicht mal soeben aus den Klamotten. Weil der Autor aber seinerseits ja ein profilierter Kritiker der neoliberalen Deregulierungspolitik ist, sind seine Sichtweisen dennoch mehr als erhellend und zeigen zudem Klimabewegten und Anhänger*innen einer nachhaltigen Wirtschaft rigoros liebgewonnene Widersprüche der eigenen Argumentation auf. Nur wenn man sich auf solche kritischen Einwürfe einlässt, entgeht man der Gefahr, es sich in seiner eigenen Degrowth-Blase bequem zu machen. Und was man dem Buch „Der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft“ wirklich danken kann, ist die zentrale Botschaft: Beschäftigt euch auch mit den ökonomischen Zusammenhängen, liebe Gretas der Welt, und überwindet den moralistischen Wohlfühl-Konsens, dass die Politik nur auf die Naturwissenschaft hören müsse. Auch wenn diese Botschaft die Massen bewegt, es geht nicht ohne ökonomischen Sachverstand. Heiner Flassbeck hat davon jedenfalls eine Menge im Angebot.
____________________________________________
[1] Flassbeck, Heiner: Der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft. Lassen sich Ökonomie und Ökologie versöhnen? Frankfurt: Westend Verlag. 2020.
[2] Massarrat, Mohssen: Das Dilemma der ökologischen Steuerreform. Plädoyer für eine nachhaltige Klimapolitik durch Mengenregulierung und neue politische Allianzen. Metropolis-Verlag, Marburg. 2000.