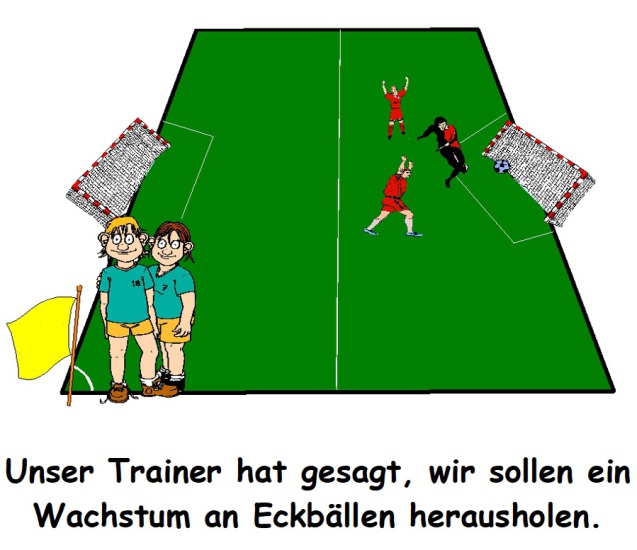Nagelsmann und das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes
September 2025
Julian Nagelsmann ist noch im Amt. Rudi Völler warf das Handtuch. Beide gewannen als Fußball-Nationaltrainer das Eckballverhältnis, verloren aber das Spiel. Was das Ganze mit der Wirtschaftslage in Deutschland zu tun hat? Eine Menge.
2004 trat der damalige Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft, Rudi Völler, nach der 1:2-Niederlage gegen Tschechien und dem Vorrundenaus bei der EM in Portugal von seinem Amt zurück. Alle Feldüberlegenheit der Nationalelf hatte nichts geholfen, 58% Ballbesitz, 9:1 Eckbälle holten Ballack, Podolski & Co. seinerzeit gegen das Nachbarland. Doch die Tore schossen die Tschechen und schieden erst gegen den späteren Europameister Griechenland im Halbfinale aus.
21 Jahre später heißt der Teamchef Julian Nagelsmann. Soeben versemmelte seine Mannschaft den Auftakt zur WM-Qualifikation mit einer 0:2-Niederlage gegen die Slowakei. Statistiker staunten nicht schlecht: Deutschland hätte mit 70% Ballbesitz und 8:5 Ecken eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen.
Fußballfans nehmen solche Rechenexempel zahlloser Sport-Portale nachvollziehbarerweise nicht wirklich ernst. Sie pflichten dem alten Trainer-Fuchs Otto Rehhagel, 2004 Europameistermacher in Griechenland, bei: „In diesem Geschäft gibt es nur eine Wahrheit: Der Ball muss ins Tor.“
Szenenwechsel. Deutschland, Wirtschaftsjammerland 2025. Von der längsten Rezession seit Gründung der Bundesrepublik ist die Rede.(1) Tatsächlich ist der als „Bruttoinlandsprodukt“ bezeichnete Güterberg der Jahre 2023 und 2024 mit -0,9% und -0,5% sogar stärker geschrumpft als vom Statistischen Bundesamt ursprünglich berechnet.(2) Die wachstumsgewohnte Öffentlichkeit gerät in Panik. Offenbar hat Deutschland bisher unbekannte ökonomische Probleme.
Der Blick in den Alltag zeigt ein differenzierteres Bild. Im Supermarkt quellen die Regale über mit 35 Sorten Joghurt. Die Inflation der letzten Jahre hat das Preisniveau mitunter deutlich angehoben, doch Euro-Shops bieten Plastikschrottprodukte im Dutzend. Und die Tourismusbranche feiert einen Reiserekord nach dem anderen.(3) Offensichtlich jammern die Deutschen auf hohem Niveau. Gleichzeitig wächst die Zahl der Pfandflaschensammler*innen in den Innenstädten gefühlt von Jahr zu Jahr. Dafür sanken die Treibhausgasemissionen Deutschlands 2024 um 3,4%.(4)
Alles Symptome der „Wirtschaftskrise“ eines stagnierenden oder schrumpfenden Bruttoinlandsprodukts? Obwohl die These vom „Trickle-down-Effekt“ des Wirtschaftswachstums sogar von Marktliberalen aufgegeben worden ist(5), klammern sich Wirtschaftspolitiker, -journalisten und -wissenschaftler*innen an das BIP als alles dominierende Zielgröße der Politik. Im Wachstumsnarrativ wird dessen mangelnde Zunahme dann als „Wirtschaftskrise“ oder „Rezession“ gedeutet und zum medialen Schlachtfeld wirtschaftspolitischer Ratschläge aller Couleur.
Das Bruttoinlandsprodukt, eine Nebelkerze
Dabei sind viele Mängel des Bruttoinlandsprodukts seit Jahrzehnten bekannt und längst Thema auch des Ökonomieunterrichts: Es steigt durch Umweltzerstörung und Krankheiten, übersieht im groben Stil Wohlfahrtsgewinne durch Carearbeit und Ehrenamt und kann überhaupt keine Aussage über die Verteilung des Wohlstandes treffen. Gerade in Ländern des Globalen Südens führt das BIP komplett in die Irre, denn die Produktionsgewinne können auch ins Ausland abfließen und die lokale Bevölkerung in Armut zurücklassen. Nur dass das Wirtschaftswachstum bei linearem Verlauf mathematisch immer geringer ausfallen muss, hat sich immer noch nicht herumgesprochen. Alles in allem lässt sich konstatieren, dass das BIP in etwa so viel mit dem Leben der Menschen zu tun hat wie das Eckballverhältnis beim Fußball mit dem Endergebnis: Aus einer Ecke kann immer auch mal ein Tor entstehen, aber als Strategie zur Erringung einer Meisterschaft taugt sie nicht. Dazu gehört wesentlich mehr und bedarf es variabler Matchpläne.
Um einen Einwand vorwegzunehmen, selbstverständlich ist das BIP mit dem Arbeitsmarkt verbunden. Sinkt das BIP, wird vermutlich die unternehmerische Nachfrage nach Arbeitskräften abnehmen. Marktliberale führen diese auf ein Kostenproblem der Unternehmen zurück und fordern – wie aktuell die Bundesregierung – mal wieder einen Abbau des Sozialsystems.(6) (Post-)Keynesianer und MMTler hingegen sehen diesen als kontraproduktiv und erkennen eine Nachfragelücke auf Seiten der Unternehmen, Haushalte und des Auslands. Sie fordern mehr Staatsausgaben zur Stützung der volkswirtschaftlichen Gesamtnachfrage.(7) Doch ernüchtert die Fantasielosigkeit von sowohl Neoklassikern als auch keynesianischen Makroökonomen, wenn es um weitere Ansätze zur Erklärung der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt geht. Denn ein Großteil der Arbeitslosigkeit hat strukturelle Ursachen, die nicht über eine einfache quantitative Stimulierung der Gütermärkte angegangen werden können: schlechte oder unpassende Qualifikation der Arbeitssuchenden, regionale Strukturbrüche, geopolitische Verwerfungen. Doch die Ratschläge der Wirtschaftsweisen und ihrer heterodoxen Kritiker*innen laufen zumeist auf dasselbe hinaus: Viel hilft viel, mehr Eckbälle braucht das Land!
Am BIP führt ein Weg vorbei
Angesichts der Omnipräsenz statistischer Daten, übersehen wir zu oft das Wesentliche: Genausowenig wie Ballbesitz oder Eckballquote sind Wirtschaftswachstum und sogar (Erwerbs-)Arbeit kein Selbstzweck. In der Wirtschaft sollte es um die Schaffung von Wohlstand gehen. Will man das Fußballspiel gewinnen, muss der Ball ins Tor. Das ist der „Wohlstandsindikator des Fußballs“. Was in Wirtschaftsdebatten vollkommen aus dem Blick verloren wird, ist die Frage, wie sich das Wohlergehen der Menschen über weitere BIP-Produktionsrekorde hinaus wirklich verbessern ließe. Auf welchen Indikator sollte eine (gemeinwohlorientierte) Wirtschaftswissenschaft (und -lehre) dann fokussieren? Die Zahl der Rentner*innen, die vom Flaschensammeln leben, fiele mir spontan ein... Jenseits von Sarkasmus wären Bruttonationaleinkommen (BNE), Volkseinkommen oder das „Verfügbare Einkommen“ besser geeignet, denn sie zeigen auf, was am Ende des Tages tatsächlich in den Taschen der Bürger und Bürgerinnen ankommt. Damit messen sie den Wohlstand der Gesamtbevölkerung wesentlich zielgenauer als das Bruttoinlandsprodukt. Genauso wie das BIP werden sie in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung bereits seit vielen Jahren erhoben, nur kümmern sich Gazetten, Politiker*innen und ihre Follower nicht um sie.
Da dann aber noch nicht geklärt wäre, ob Otto und Ottilie Normalverbraucher oder unsere Milliardäre profitiert haben, wäre zusätzlich der Gini-Koeffizient geeignet, den Grad der Gleichverteilung des Wohlstands auf die Haushalte anzuzeigen. Um gesellschaftlichen Frieden bewahren, ist bekanntlich die Verteilung von Einkommen und Vermögen noch entscheidender als deren absolute Höhe (Easterlin-Paradoxon).
Dicke Bretter
Es braucht also nicht unbedingt neue Wohlstandsindikatoren, die erst wieder von Kommissionen oder Lehrstühlen ersonnen werden müssen und dann in den Schubladen alternativökonomischer Organisationen verschwinden. Es bedürfte lediglich einer Aufwertung bisher unterrepräsentierter Indikatoren und der bewussten Abkehr vom Bruttoinlandsprodukt. Leichter gesagt als getan. Den Vergleich mit dem Eckbällen hatte ich schon vor zwanzig Jahren in einem meiner ersten Vorträge zum Wirtschaftswachstum bemüht. Geändert hat sich seither nichts. Denn es gibt eine schier unermessliche Zahl an Wissenschaftlern, Publizisten, Politikern, Lobbyisten, Journalisten, Kommentatoren in den sozialen Medien, Bloggern und, ja, auch Wirtschaftspädagog*innen, die sich auf die Steigerung des Eckenverhältnisses eingeschossen haben. Die Debatte wird dann nicht nur über das BIP selbst geführt, sondern über seine Aliasse: Wachstum, Wachstum, Wachstum, die Konjunktur muss „angekurbelt“ werden, „Die Wirtschaft“ bricht zusammen. Zu diesem Thema sind wir ein Volk von Nationalwirtschaftstrainern und jede*r hat eine Meinung.
Julian Nagelsmann hat einen Weg aus der Ergebnisrezession gefunden. Drei Tage nach dem Slowakei-Spiel schlug seine Nationalelf Nordirland mit 3:1. Bemerkenswert: das Eckenverhältnis entschieden diesmal die Nordiren mit 5:3 für sich. Eine Wirtschaftskrise wird dort aktuell allerdings nicht beklagt.
_____________________________________________________-
(1) www.telepolis.de/features/Droht-Deutschland-die-laengste-Rezession-seit-Jahrzehnten-10578007.html